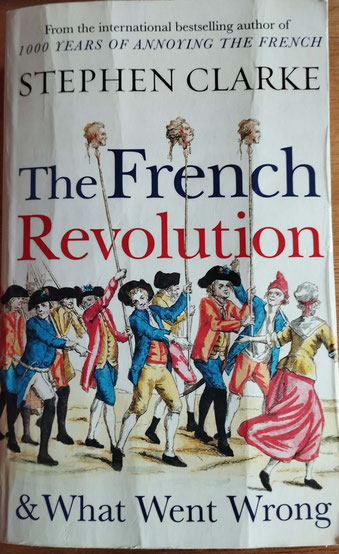
Heute, am 14. Juli, dem Jahrestag des Sturms auf die Bastille, stelle ich ein weiteres Buch von Stephen Clarke vor: The French Revolution & and what went wrong.
Wie Clarke selbst in seiner Einleitung bemerkt, reduziert sich die Französische Revolution in der Vorstellung vieler Menschen auf ein dramatisches, wenige Wochen andauerndes Ereignis im Sommer 1789: Adlige werden gezwungen, ihre Besitztümer an das hungernde Volk abzutreten, träge Großgrundbesitzer enteignet, und ein despotischer König mitsamt seiner verschwenderischen Gattin wird entmachtet und schließlich auf „humane“ Weise hingerichtet. Anschließend, so das gängige Narrativ, übernimmt eine Gruppe wohlmeinender, philosophisch gesinnter Demokraten die Macht und sorgt unverzüglich für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit im gesamten französischen Volk.
Tatsächlich, so Clarke, existierte bereits vor dem 14. Juli 1789 ein demokratisch gewähltes Parlament. Und es wurde an einer neuen Verfassung gearbeitet, die Louis XVI. weiterhin als Staatsoberhaupt vorsah – niemand hatte die Absicht, den König abzusetzen, geschweige denn zu töten. Louis XVI. war sogar Ehrengast bei der Feier des ersten Jahrestags des Bastille-Sturms und wurde bei der Gelegenheit vom Volk gefeiert.
Es musste also einiges aus dem Ruder laufen, damit aus einer zunächst vergleichsweise friedlichen Revolution ein ausgewachsener Bürgerkrieg werden konnte. In den Jahren des sogenannten Terreur, die auf den Sturz der Monarchie folgten, fielen bis zu 300.000 Französinnen und Franzosen Massenhinrichtungen und politischer Verfolgung zum Opfer.
Wie es dazu kam, beschreibt Clarke auf sehr unterhaltsame Weise. Er holt weit aus, ein Tag am Hof des Sonnenkönigs Louis XIV wird in allen Details dargestellt: jeder Handgriff, vom Öffnen der königlichen Bettvorhänge über das Entleeren des königlichen Nachttopfes bis zum abendlichen Entkleiden war streng geregelt. Und fand unter den Augen des Hofstaates statt, die teuer für das Privileg bezahlten, dem König einmal beim Ankleiden zuzusehen oder in einem der Gänge darauf zu warten, dass der König vorbeikam und womöglich das Wort an sie richtete.
Auch über Ludwig XVI. und Marie-Antoinette erfährt man bei Clarke einiges, das über das gängige Bild hinausgeht: Ludwig XVI. war handwerklich interessiert und zeigte große Faszination für neue technische Entwicklungen. Im Palast ließ er eine eigene Schmiede einrichten, beschäftigte sich intensiv mit Schlossmechanik und nahm Unterricht bei einem renommierten Uhrmacher. Marie-Antoinette wiederum durchlief eine bemerkenswerte Wandlung – von der jungen, anfangs beim Volk beliebten österreichischen Prinzessin zur als verschwenderisch verschrienen Königin, der man später den berühmten (wenn auch vermutlich nie geäußerten) Satz unterstellte: Das Volk solle doch Brioche essen, wenn es kein Brot habe.
Auf den über 500 Seiten seines Buches findet Clarke auch reichlich Raum für Ausflüge in das Alltagsleben gewöhnlicher Franzosen, die Philosophie der Aufklärung, die Entstehung der Marseillaise und vieles mehr. Seine Recherchen stützen sich auf umfangreiches Material aus französischen Archiven, darunter Tagebücher, Briefe und andere zeitgenössische Dokumente.
Eine sehr empfehlenswerte Lektüre!